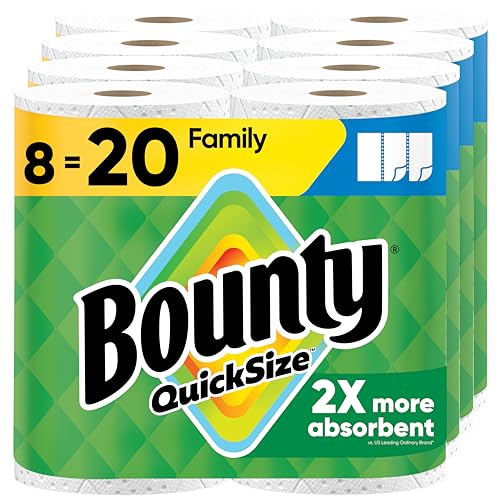Player FM - Internet Radio Done Right
12 subscribers
Checked 6m ago
Tilføjet six år siden
Indhold leveret af Südwestrundfunk. Alt podcastindhold inklusive episoder, grafik og podcastbeskrivelser uploades og leveres direkte af Südwestrundfunk eller deres podcastplatformspartner. Hvis du mener, at nogen bruger dit ophavsretligt beskyttede værk uden din tilladelse, kan du følge processen beskrevet her https://da.player.fm/legal.
Player FM - Podcast-app
Gå offline med appen Player FM !
Gå offline med appen Player FM !
Podcasts der er værd at lytte til
SPONSORERET
S
Smart Travel: Upgrade Your Getaways

1 Cash or Miles? The 2025 Points Valuations That Could Change How You Travel 42:36
42:36  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked42:36
Liked42:36
Get fresh NerdWallet data on what your points and miles are really worth in 2025 — and why the answer might change how you book travel. Should you take a $650 flight voucher or 32,500 miles? How much are your points and miles actually worth? Hosts Sally French and Meghan Coyle break down the latest NerdWallet valuations to help you make smarter redemption choices. But first, they cover the week’s biggest travel headlines, including Southwest Airlines’ new partnership with EVA Air, Frontier’s companion certificate promotion and status match, and JetBlue opening up award bookings with Condor Airlines. Then, travel Nerd Craig Joseph joins Meghan to discuss NerdWallet’s latest airline, hotel, and credit card point valuations, with tips and tricks on comparing loyalty programs, maximizing transfer partners, and deciding when cash is more valuable than points. They also discuss the impact of devaluations, how close-in bookings can save you points, and why premium cabins can sometimes offer outsized redemption value. Plus: Craig’s hot take on airport lounges. Card benefits, terms and fees can change. For the most up-to-date information about cards mentioned in this episode, read our reviews: Is the Frontier Airlines World Mastercard Worth Its Annual Fee? https://www.nerdwallet.com/article/travel/is-the-frontier-airlines-world-mastercard-worth-its-annual-fee Citi Strata Credit Card Review: Solid Rewards for No Annual Fee https://www.nerdwallet.com/reviews/credit-cards/citi-strata Citi Double Cash Review: A Solid Choice for Everyday Spending https://www.nerdwallet.com/reviews/credit-cards/citi-double-cash Citi Custom Cash Card Review: Low-Maintenance 5% Cash Back https://www.nerdwallet.com/reviews/credit-cards/citi-custom-cash Citi Strata Premier: Big Rewards Across Top Spending Categories https://www.nerdwallet.com/reviews/credit-cards/citi-strata-premier Is the New Alaska Atmos Summit Card Worth a $395 Annual Fee? https://www.nerdwallet.com/article/travel/is-the-alaska-airlines-atmos-summit-card-worth-its-annual-fee Resources discussed in this episode: Airline Miles vs. Cash Calculator https://www.nerdwallet.com/article/travel/calculator-should-you-book-a-flight-with-cash-or-miles How Much Are Travel Points and Miles Worth in 2025? https://www.nerdwallet.com/article/travel/airline-miles-and-hotel-points-valuations Want even more tips and tricks to get the most out of your travel dollars? Subscribe to TravelNerd , our free newsletter designed to help you crack the code on spending less on your travel. In this episode, the Nerds discuss: points and miles valuation, airline miles value, hotel points value, credit card points value, Southwest EVA Air partnership, Frontier Companion Certificate, JetBlue Condor award booking, Citi American Airlines transfer, Amex Membership Rewards value, Capital One points value, Bilt points value, Hyatt points value, Hilton points value, Marriott points value, Wyndham points value, IHG points value, Alaska miles value, JetBlue points value, American Airlines miles value, United miles value, Southwest points value, Virgin Atlantic miles value, ANA miles value, Avianca LifeMiles value, best way to use Amex points, best way to use Citi points, best way to use Capital One points, use cash or points for flights, last minute award flight value, premium cabin redemption value, economy flight points value, airline devaluation, hotel point devaluation, cash vs points travel booking, when to transfer credit card points, how to maximize travel rewards, and NerdWallet points and miles calculator. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices…
SWR2 Kultur Aktuell
Marker alle som (u)afspillede ...
Manage series 2550181
Indhold leveret af Südwestrundfunk. Alt podcastindhold inklusive episoder, grafik og podcastbeskrivelser uploades og leveres direkte af Südwestrundfunk eller deres podcastplatformspartner. Hvis du mener, at nogen bruger dit ophavsretligt beskyttede værk uden din tilladelse, kan du følge processen beskrevet her https://da.player.fm/legal.
Welche Bücher sind neu, was läuft im Kino, wie sieht die Festivalsaison aus und worüber diskutieren Kulturwelt und Kulturpolitik? Im Podcast SWR Kultur Aktuell widmen wir uns täglich den Nachrichten, mit Hintergründen, Gesprächen, Kritiken und Tipps. Damit Sie nichts Wichtiges mehr verpassen! Zur Sendung in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/swr2-kultur-aktuell/12779998/
…
continue reading
105 episoder
Marker alle som (u)afspillede ...
Manage series 2550181
Indhold leveret af Südwestrundfunk. Alt podcastindhold inklusive episoder, grafik og podcastbeskrivelser uploades og leveres direkte af Südwestrundfunk eller deres podcastplatformspartner. Hvis du mener, at nogen bruger dit ophavsretligt beskyttede værk uden din tilladelse, kan du følge processen beskrevet her https://da.player.fm/legal.
Welche Bücher sind neu, was läuft im Kino, wie sieht die Festivalsaison aus und worüber diskutieren Kulturwelt und Kulturpolitik? Im Podcast SWR Kultur Aktuell widmen wir uns täglich den Nachrichten, mit Hintergründen, Gesprächen, Kritiken und Tipps. Damit Sie nichts Wichtiges mehr verpassen! Zur Sendung in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/swr2-kultur-aktuell/12779998/
…
continue reading
105 episoder
すべてのエピソード
×S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Hörspiel trifft Zukunft – Die ARD-Hörspieltage 2025 starten 3:41
3:41  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked3:41
Liked3:41
Science Fiction ist das Motto Anouk und Andri sind als Pionierinnen der Menschheit im All unterwegs. Gesucht wird eine neue Heimat, denn der blaue Planet ist quasi unbewohnbar geworden. „Unearthing“ heißt die achtteiligen Science-Fiction-Serie von Erik Wunderlich. Bei ihrer Reise durchs Weltall sollten Anouk und Andri allerdings aufpassen, dass sie nicht mit dem schrottreifen Raumschiff von Lieutenant Quent und seiner chaotischen Crew aus dem Hörspiel „Happiness is a warm spaceship“ zusammenstoßen. Im Ohr entstehen neue Welten Die ARD-Hörspieltage haben mit „Science Fiction“ zum ersten Mal einen inhaltlichen Schwerpunkt gewählt. „Im Hörspiel braucht man keine großen Kulissen, um wirklich aufsehenerregende Effekte zu erzielen. Die Welten entstehen im Kopf“, erklärt die neue Leiterin des Festivals, Mareike Maage, vom Südwestrundfunk „Dafür sind das Radio und das Hörspiel einfach fantastisch geeignet." „Der Krieg der Welten“ von Orson Welles Und weil Science Fiction seit den Anfängen im Hörspiel besonders beliebt ist, soll in der „Nacht des Hörspiels“ am Samstag eine kleine Zeitreise unternommen werden: „Wir gucken auf Musiken, die in Science-Fiction-Filmen und auch im Hörspiel verwendet werden. Dann gucken wir auf Science Fiction in der DDR“, sagt Maage. „Außerdem schauen wir auf neue Erzählformen und aktuelle Trends unter den Autoren.“ Und natürlich darf, wenn man über Science Fiction im Hörspiel spricht, „Der Krieg der Welten“ von Orson Welles nicht fehlen – den Klassiker gibt es bei dem Festival als Live- Hörspiel, in einer Fassung von Oliver Rohrbeck und der Lauscherlounge . Neun neue Hörspiele werden im ZKM Karlsruhe vor Publikum präsentiert Doch Hörspiel kann natürlich nicht nur Reisen in die Zukunft, sondern zum Beispiel auch Bahnfahrten an die Ostsee. Das Hörspiel „Windstärke 17“ nach dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Caroline Wahl eröffnet am Freitagvormittag den Reigen der öffentlichen Hörspiel-Vorführungen. Insgesamt neun Neuproduktionen haben ARD, Deutschlandfunk, SRF und ORF für das Festival ausgewählt. Die Hörspiele werden in ganzer Länge vor Publikum im „Klangdom“ des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien präsentiert – und dann mit den Macherinnen und Machern besprochen. Um die Zukunft des Hörspiels muss man nicht fürchten Das Hörspiel ist ein überaus vielfältiges, wandlungsfähiges Medium, dass sich im Verlauf seiner Geschichte immer wieder durch neue Produktionsmöglichkeiten und Nutzungsverhalten seiner Fans verändert hat, sagt Festivalleiterin Mareike Maage: „Das Hörspiel ist so ein breites und agiles Instrument, mit dem Kunst gemacht wird, dass ich wirklich nach wie vor begeistert bin, was da für Produktionen herauskommen und was für Impulse gesetzt werden.“ Um die Zukunft des Hörspiels muss man also nicht fürchten. Nicht so lange Menschen gerne Geschichten erzählt bekommen, wie die Hörspiel-Serie „1001 Nacht“ belegt: Du kannst jetzt nicht aufhören, zu erzählen – deine Geschichte ist so unglaublich spannend! Und Schahrasad antwortete: Das ist noch gar nichts gegen das, was ich euch morgen Nacht erzählen werde! Quelle: Hörspielserie 1001 Nacht…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Bücherfestival Baden-Baden: Carsten Otte im Gespräch mit Kaleb Erdmann („Die Ausweichschule“) 5:40
5:40  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked5:40
Liked5:40
Verarbeitung des Amoklaufs am Erfurter Gutenberggymnasium Als „heiteres Trauerbuch“ beschreibt Otte den Roman, der in diesem Jahr auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. Er handelt vom Amoklauf am Erfurter Gutenberggymnasium 2002, den Autor Kaleb Erdmann selbst miterlebt hat. Für Carsten Otte ist „Die Ausweichschule“ deshalb auch ein autofiktionaler Roman über die Grenzen des Schreibens. Einer in dem die Tat aus Sicht des elfjährigen Erzählers geschildert wird. Der Amoklauf habe in den Schülerinnen und Schülern lange nachgewirkt, „in ihnen gegärt“, aber Kaleb Erdmann habe auch „diesen wunderbaren Roman geschrieben“, so Carsten Otte.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Zu Gast bei den ARD Hörspieltagen: Der Hörspielkünstler und Synchronsprecher Oliver Rohrbeck 14:30
14:30  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked14:30
Liked14:30
40 Jahre Justus Jonas aus „Die drei ???“ Justus Jonas in der Hörspielserie „Die drei ???“ spielt Oliver Rohrbeck seit über 40 Jahren. Daneben sprach er in unzähligen Filmen wie „Grisu der Kleine Drache“, Gru in „Ich – Einfach unverbesserlich“ und er ist die deutsche Stimme von Ben Stiller. Daneben inszeniert er Live-Hörspiele mit tausenden von Besuchern. In SWR Kultur am Abend spricht Oliver Rohrbeck darüber, wie er es schafft, auch noch als Sechzigjähriger den Jugendlichen Justus Jonas aus „Die drei ???“ zu spielen. Er versuche dafür nicht, seine Stimme jünger zu machen, sondern finde aus einer schauspielerischen Spielhaltung heraus in die Rolle des Achtzehnjährigen, sagt er. Orson Welles Radioevent „Krieg der Welten“ als Live-Hörspiel Auf den ARD-Hörspieltagen knüpft Oliver Rohrbeck an das historische Radioevent „Krieg der Welten“ von Orson Welles aus dem Jahr 1938 an. Rohrbecks neues Live-Hörspiel bezieht die Rezeption des damaligen Events mit ein und wirft aktuelle Fragen auf zur Glaubwürdigkeit der Medien angesichts wachsender Ängste in der Bevölkerung.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Psychologische Studie zu „D-Faktor“: Wie böse bin ich? 7:34
7:34  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked7:34
Liked7:34
Ein Faktor statt zahlreiche Eigenschaften „D-Faktor“ steht für „dark“, also englisch für „dunkel“. Er steht für Persönlichkeitsmerkmale, die zu bösem Verhalten führen – auf englisch „dark traits“. Prof. Benjamin Hilbig hat mit seinem Team der Rheinland-Pfälzischen Technische Universität Kaiserslautern-Landau genau dieses Phänomen untersucht – ausgehend von der Beobachtung, dass vermeintlich unterschiedliche Formen „böser“ Persönlichkeiten sich nach wissenschaftlicher Betrachtung als sehr ähnlich herausstellen. Wir wollen die Forschungslandschaft ein bisschen aufräumen. Denn es ist ineffizient, mit etwa 25 bösen Eigenschaften zu hantieren, wenn man de facto nur einen Wert braucht, nämlich den D-Faktor Quelle: Prof. Benjamin Hilbig, RPTU Kaiserslautern-Landau Selbsttest für den „D-Faktor" Mit einem Fragebogen untersuchten Hilbig und sein Team verschiedene Aspekte dieser „bösen“ Tendenzen. Darunter etwa: Sind Sie der Meinung, dass man es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen sollte? Oder: Können Sie sich vorstellen, dass es Spaß machen würde, andere Leute zu quälen? Fast drei Millionen Menschen weltweit haben den Fragebogen bisher ausgefüllt und Hilbig damit Daten für seine Forschung geliefert. Das große Echo erklärt sich Hilbig im Gespräch mit SWR Kultur unter anderem mit dem Interesse vieler, den eigenen „D-Faktor“ herausfinden zu wollen, und das anonym. Bösartigkeit nimmt im Alter ab Denn Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmende lassen sich aus dem Datensatz nicht ziehen. Dafür aber wissenschaftliche Erkenntnisse: So etwa, dass bösartige Anteile in der Persönlichkeit ohne weiteres Zutun mit dem Alter abnehmen. Auch gesamtgesellschaftlich lassen sich Schlüsse ziehen, so Hilbig. So förderten bestimmte Umwelteinflüsse den „D-Faktor“ der Bevölkerung. So seien etwa mangelnde Rechtsstaatlichkeit oder weit verbreitete Kriminalität Bedingungen, unter denen das Individuum mit einem höheren „D-Faktor“ im Zweifelsfall Vorteile habe - schlichtweg, weil es existenziell notwendig sei, sich gegen andere durchzusetzen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch: Wir dämmen den „D-Faktor“ auf gesamtgesellschaftlicher Ebene am ehesten ein, indem wir verhindern, dass es existenziell bedrohliche Armut oder Unsicherheit gibt. Quelle: Prof. Benjamin Hilbig, RPTU Kaiserslautern-Landau…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Elisa Hoven – Das Ende der Wahrheit? | Buchkritik 4:09
4:09  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked4:09
Liked4:09
Ja, es ist ein verzweifelt Ding mit der Wahrheit in diesen Zeiten von Fake News und Phishing. Eine Professorin für Strafrecht und Direktorin für Medienrecht hat sich der Thematik nun angenommen und der Verlag meint: Es sei fünf vor zwölf. In diesem Buch wird es um Wahrheit und Lügen in den großen Kommunikationsräumen gehen, in den Medien und in der Politik, um Lügen über den Klimawandel, das Corona-Virus und Kriege, um Fake News, Verschwörungserzählungen und Deepfakes, aber auch über die Wahrheit im Privaten, über Lügen für Geld oder für Sex. Quelle: Elisa Hoven – Das Ende der Wahrheit? Lüge in der Politik … Dass Lügen in der Politik, angeführt an vorderster Front von den USA, das Klima vergiften, die Köpfe verdrehen und die Unwahrheit erst hoffähig gemacht haben, streift Elisa Hoven auch. Dann richtet die Autorin ihren Blick auf deutsche Missstände. Wer nach einer gewonnenen Wahl das Gegenteil von dem tut, was er im Wahlkampf angekündigt hat, der sägt an der Glaubwürdigkeit der Politik und bereitet radikalen Parteien den Boden. Quelle: Elisa Hoven – Das Ende der Wahrheit? Propaganda in Kriegszeiten Und beim Blick zu den dominierenden Kriegsschauplätzen dieser Welt, in die Ukraine und nach Gaza, verhehlt die Juristin nicht jene Erkenntnisse, die in kurzatmiger, tagespolitischer Aufgeregtheit rasch verteufelt werden. Es ist erstaunlich, dass die Aussage – Kriegsverbrechen werden von allen Seiten begangen – überhaupt ernstlich in Zweifel gezogen wurde. Wer sich mit internationalen Konflikten beschäftigt hat, der weiß, dass es in jedem Krieg Kriegsverbrechen gibt, und dass keine Seite davor gefeit ist. Quelle: Elisa Hoven – Das Ende der Wahrheit? Plädoyer für den Zweifel Sahra Wagenknecht ist für diese Erkenntnis einst mächtig gescholten worden. Elisa Hoven behauptet, etwas naiv vielleicht, wir hätten „eine freie Presse, die weder aus der Politik noch aus der Wirtschaft gesteuert“ werde – die Abhängigkeit von Werbeeinnahmen benennt sie nicht; doch sie warnt vor Gleichförmigkeit und Anpassung in Berichterstattung und Kommentar. Frank-Walter Steinmeier sprach vor über zehn Jahren, 2014, vom hohen „Konformitätsdruck in den Köpfen der Journalisten“. Dieser führe zur Verengung des Meinungsspektrums, ja Aussparung unliebsamer Aspekte. Um der Wahrheit künftig wieder mehr Gewicht zu verschaffen, plädiert Elisa Hoven – neben Maßnahmen der Justiz und Gesetzgebung - vor allem für: den Zweifel! Und damit kann sich dann jede und jeder angesprochen fühlen. Das notwendige Gegengewicht zu Lügen und Fake News ist nicht die unbedingte Forderung nach Wahrheit, sondern der Zweifel, die Ausgewogenheit und der kritische, plurale Diskurs. (…) Wir brauchen eine neue Kultur des Zweifelns, in der nicht die Gewissheit, sondern die Suche nach der Wahrheit im Vordergrund steht. Quelle: Elisa Hoven – Das Ende der Wahrheit? Gesetze als Lösung? Die vielen Betrugsversuche und Täuschungsmanöver im Netz könnten (oder sollten zumindest) den Benutzern bekannt sein – warum aber wirken diese jüngeren Generationen gefügiger und kritikloser gegenüber Angeboten und Texten im Internet als frühere Nutzer von Texten in Zeitungen und Büchern oder auf Werbeplakaten? Diese Frage stellt sich die Autorin nicht. Oder auch: Was ist gegen das Suchtverhalten der online-Gesellschaft zu unternehmen? Und was gegen die infame Geschäftspolitik von Herrschern im Silicon Valley? Aus Sicht der Juristin, „Forschungsgebiet: Kriminalität und Strafrecht“, wie sie schreibt, macht sie verschiedene Vorschläge für Verschärfungen und Ergänzungen in Gesetzestexten, denn das Recht hinke „den aktuellen Entwicklungen hinterher“. Mitunter verliert sie sich dabei in juristische Spitzfindigkeiten, zudem vertraut sie der eigenen Berufsklasse über alle Maßen: „Menschen neigen dazu, ihre eigene Gruppe zu begünstigen“, schreibt sie zunächst, „bei Richterinnen und Richtern dürften diese Effekte geringer sein als bei anderen, denn ihre Rolle erfordert ein hohes Maß an Selbstreflexion.“ Gegen diese Einschätzung könnte man juristische Parteinahmen für Mietumwandlungen oder Rechtsprechung in Verkehrsdelikten anführen. Das Buch von Elisa Hoven gibt einen Überblick zur Problematik. Tiefergehende Ursachenforschung, auch aus psychologischer Sicht beispielsweise, könnte diese Bestandsaufnahme künftig ergänzen.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 „Der Tod ist ein Arschloch“: Filmdoku über alternativen Bestatter eröffnet Mainzer Festival „Filmz“ 3:53
3:53  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked3:53
Liked3:53
Blick auf das Menschliche in unserer Begräbniskultur Ein moderner Wohnkomplex in Berlin. Schneetreiben. Ein Mann und eine Frau klingeln. Die Kamera bleibt draußen, vor dem Gebäude, vor der Wohnungstür. Nur ihre Stimmen sind zu hören, während die Fassade mit ihren stummen Fenstern im Bild bleibt. Maria Schuster und ihr Kollege vom Bestattungsinstitut „Lebensnah“ stellen sich vor: „Wir wollten nur einmal schnell gucken, wo Frau Kord ist, gucken, wie wir sie am besten abholen können.“ Die Abholung der toten Frau Kord findet nur im Kopf des Zuschauers statt. Ihre Leiche sieht man nicht. Der Dokumentarfilm „Der Tod ist ein Arschloch“ richtet den Blick auf das Menschliche in unserer Begräbniskultur. Empathie für die Angehörigen, aber auch für die Toten. Ein ehemaliger Bandmanager gründet ein Bestattungsunternehmen Das ist, was sich das alternative Bestattungsunternehmen „Lebensnah“ mit seinem Gründer Eric Wrede auf die Fahnen geschrieben hat. „ Es ist Irrsinn, wie viele Menschen mit einer althergebrachten Form des Bestattens überhaupt nichts anfangen können“, sagt Wrede. „Wir haben ja von Anfang an versucht, Abschiede so anzubieten, wie wir selber es gerne hätten.“ Eric Wrede, ein ehemaliger Bandmanager, arbeitet mit drei Bestatterinnen, die auch einen beruflichen Neustart gewagt haben. Ihre Erfahrungen aus Werbung, Kosmetik und Kunst bringen sie mit ein. Die frühere Fernsehschauspielerin Maria Schuster etwa begleitet die Beerdigungen nun musikalisch. Lange Entstehungsphase des Dokumentarfilms Die Idee zum Dokumentarfilm entwickelte der Mainzer Regisseur Michael Schwarz über Jahre. Ein Auslöser: eine Lesung zu Eric Wredes Buch „The End“. Erfahrungen aus dem persönlichen Umfeld mit weniger empathischen Bestatterinnen bewogen ihn dazu, dem Bestatter eine lange E-Mail zu schreiben. 2020 gingen die Filmarbeiten los. „Ich bin wirklich wochenlang mitgelaufen und habe im Prinzip so eine Art von Praktikum dort gemacht“, erinnert sich Michael Schwarz. Medienförderung Rheinland-Pfalz füllte eine Lücke Ausdauer und Hingabe prägen auch die Karriere von Michael Schwarz. Nach ersten Jobs bei der Bavaria Filmproduktion studiert er in Mainz Theaterwissenschaften und entdeckt dort an der Filmklasse den Dokumentarfilm. 2009 gründet er mit einem Studienfreund die Produktionsfirma Nachtschwärmerfilm. Die finanziert sich zur Hälfte über Imagefilme, zur anderen Hälfte über freie Kinodokumentarfilme; lange ein Risiko, da es in Rheinland-Pfalz keine Filmförderung gab. Erster Dokumentarfilm, der das Festival „Filmz“eröffnet Das änderte sich 2021 mit der Medienförderung Rheinland-Pfalz. „Man merkt jetzt gerade, da kommt auch so ein richtiger Schwung rein“, sagt Michael Schwarz. „Alle sind richtig motiviert, spannende Projekte zu machen.“ Eines der ersten geförderten Projekte war „Der Tod ist ein Arschloch“. Jetzt eröffnet das Werk das Festival „Filmz“ – als erster Dokumentarfilm. Michael Schwarz kann dabei mit großem Zuspruch rechnen – nicht nur, weil Mainz für ihn ein Heimspiel ist, sondern auch, weil es zum Thema Tod offenbar großen Redebedarf gibt.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Fotoklassen der Kunsthochschulen – Famose Fotoausstellung „Playlist“ rockt die Staatsgalerie Stuttgart 3:55
3:55  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked3:55
Liked3:55
Einladung an die Fotoklassen Wenn eine Klasse einer Kunsthochschule die Einladung bekommt, in einer veritablen Staatsgalerie auszustellen, dann ist das ein Angebot von der Sorte, die man nicht ablehnen kann. Obwohl vom ersten Moment an der Druck im Raum stand, dass auf so einem Niveau einfach alles klappen muss; schildern die Stuttgarter Studentin Xenia Wahl und ihre Fotografie-Professorin Ulrike Myrzik von der Akademie der Bildenden Künste am Weißenhof. Die Einladung der Staatsgalerie ging parallel auch an die Professorin Anja Weber von der Stuttgarter Merz-Akademie. Es mussten sich also zwei Fotoklassen erst einmal zusammenraufen – 30 Studierende mit teils völlig unterschiedlichen Hintergründen und Herangehensweisen. Genau darin liegt aber auch der Reiz des Projektes, so Weber. Wie schaut die Gen Z auf diese Welt? Anja Weber: „Die meisten sind aus dieser Generation, die eigentlich vollständig im digitalen Zeitalter aufgewachsen ist und die auch eben diese Corona-Pandemie sehr stark abbekommen haben. Und diese Lebensrealitäten dieser Studierenden, die wollten wir anerkennen erstmal und schauen, wie gucken die eigentlich auf die Welt.“ Schlüsselbegriff und gleichzeitig Titel der Ausstellung ist „Playlist“ – eigentlich eine persönliche Auswahl von Musiktiteln, digital zusammengestellt. Für die Ausstellenden steckt in „Play“ und „List“ die Spannung zwischen individuellem Spiel und äußeren Faktoren wie Einordnen und Bewerten, erklärt Anja Weber. Das wird an Themen wie Diskriminierung und Gleichberechtigung durchgespielt: Frauen im Handwerk, Powergirls in feministischen Rock-Bands, Lebensfreude und Stärke von Musliminnen. „Playlist“ schlechter Nachrichten aus der Ukraine Mitten aus dem aktuellen Weltgeschehen kommen die Bilder von Mariia Sviatohorova . Die Ukrainerin, die seit zweieinhalb Jahren in Stuttgart studiert, hat Heimatbesuche bei ihren Eltern in Kiew fotografiert. Hier bedeutet „Playlist“ die zermürbende Dauerschleife von Angst und schlechten Nachrichten. Nicht-Ukrainer haben das Privileg kleinerer Sorgen. Xenia Wahl hat Wachsblöcke auf den Fußboden gestellt, in denen Fotos eingeschmolzen sind – unscharfe, im Trüben versinkende Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit. Utopische Power kommt aus der Musik Für die schönen Momente ist in der Ausstellung „Playlist“ immer wieder die utopische Power zuständig, die jede Generation aufs Neue in ihrer Musik findet. Hier sind es ziemlich punkige, rebellische Sounds, wie von der Londoner Frauen-Anarcho-Band „Petrol Girls“. Deren Song „Sister“ endet mit einem Dreiklang von Worten, auf die sich wohl alle Akteure dieser hinreißend quirligen und schillernden Playlist einigen können: Freundschaft, Solidarität, Liebe.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 „Meister der Apokalypse“ – ARD-Doku zum 70. Geburtstag von Roland Emmerich 2:49
2:49  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked2:49
Liked2:49
Stimmung am Set mir Emmerich ist top Über Roland Emmerich sprechen die, die mit ihm direkt gearbeitet haben, eigentlich immer in den höchsten Tönen: Mel Gibson, Jeff Goldblum, sein ehemaliger Co-Autor Dean Devlin oder der Effektmeister Volker Engel: die Stimmung am Set immer top, die Ansagen klar, die Vision nachvollziehbar. Und die Erfolgsbilanz ist trotz oft mäßiger Kritik atemberaubend. Emmerich wird immer noch unter den Top 20 der Hollywood-Regisseure geführt, die die meisten Gewinne eingefahren haben. Da kann man ihm ein bisschen Exzentrik durchgehen lassen. Anfang als Ausstatter bei der Filmhochschule München Roland Emmerich hat beeindruckende Häuser in Los Angeles und London. Als Kunstsammler erwirbt er auch Skurrilitäten wie chinesische Propaganda-Art. Der, der mal als Ausstatter bei der Filmhochschule München angefangen hat, legt Wert darauf, Dinge, die möglicherweise am falschen Platz stehen, zurecht zu rücken. Sein langjähriger Wegbegleiter Jo Müller zeigt ihn als einen Regisseur, der auch über seine Filme und deren Wirkung immer wieder nachdenkt. „The day after tomorrow“ von 2004 wurde der erste Popcorn-Klimakatastrophenfilm. In dem Zusammenhang sprach Emmerich vergangenes Jahr zum ersten Mal in einem Interview von einem überstandenen Hirntumor und wie das seinen Blick auf Filme und das Leben verändert habe. In der Doku tritt er einem immer wieder als ziemlich geerdeter Privatmensch entgegen. „Schwäbischer Alien“ in Hollywood Man muss seine Filme nicht lieben, um seine Biografie und seinen Erfolg als Summe richtiger Entscheidungen zu betrachten: Als Spross einer Stuttgarter Unternehmerfamilie war der Schritt nach Hollywood ein kalkulierbares Risiko. Als schwäbischer „Alien“ ist er dort gelandet und genau wie seine Schwester, die seine Filme produziert, in den USA heimisch geworden. Wurde er anfangs noch als „Spielbergle aus Sindelfingen“ belächelt, ist Emmerich schon lange seine eigene Marke. Mag sein, dass ihn viele vor allem mit Special Effects verbinden, mit Untergangsgrusel und einer flachen und klischeebeladenen Handlung und dass zuletzt die ganz großen Erfolge ausgeblieben sind. Andererseits steht er in der Tradition von Regisseuren, die mit emotionalen Geschichten aufwühlende Themen anpacken. Der Klimawandel treibt ihn um. Die Warnung vor unvernünftiger, profitgeiler Politik. Das Weiße Haus hat er in seinen Filmen schon mehrfach in die Luft gehen lassen. Spannender Mix von Dokumentation und Interviews Die Doku mixt immer wieder hochspannende Aufnahmen von früheren Dreharbeiten, kurze ältere Interviewschnipsel mit Blicken in Emmerichs Seelenleben kurz vor seinem 70. Geburtstag. Dazu gehört der offene Umgang mit seiner Homosexualität, der einem im Filmgeschäft auch im Weg stehen könne Insgesamt ist „Meister der Apkalypse“ eine Hommage an einen weltoffenen, engagierten Skeptiker, der trotz Zweifel an der menschlichen Lernfähigkeit das Leben feiert, der sich die Neugier bewahrt hat für Technik, junge Menschen und ihre Ideen und sich in einem aufgeregten, häufig oberflächlichen Umfeld nicht hat von seinem Weg abbringen lassen.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Rotz und Wasser im Kinosessel – Das IFFMH feiert die Emotionen des Films 7:10
7:10  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked7:10
Liked7:10
Kino löst Gefühle aus Festivalleiter Sascha Keilholz erklärt, das Motto der Retrospektive „Rotz und Wasser“ passe perfekt zum diesjährigen Schwerpunkt, denn: „Wir beschäftigen uns mit der Emotionsmaschine Kino und den Gefühlen, die das Kino in uns auslöst.“ Besonders beeindruckt zeigt sich Keilholz von einer neuen Generation Filmschaffender, „die einen eigenen Rhythmus haben, ein eigenes Tempo und ihre persönlichen Geschichten erzählen.“ „Ein großes Jahr für Dokumentarfilme“ Auch der Dokumentarfilm spiele eine zentrale Rolle, betont er: „Es ist ein großes Jahr für Dokumentarfilme – und zugleich eine schöne Gelegenheit, unsere Tradition neu zu beleben.“…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Ersi Sotiropoulos – Was bleibt von der Nacht 4:09
4:09  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked4:09
Liked4:09
Kaum etwas ist überliefert über die drei Tage, die Konstantinos Kavafis im Paris der Belle Époque verbrachte. Im Juni 1897 war er 34 Jahre alt und befand sich mit seinem älteren Bruder auf einer Europa-Reise. Kavafis, der bis heute griechische Schriftsteller und Schriftstellerinnen inspiriert, war damals noch weit entfernt vom Ruhm, seine Lyrik war unausgereift und mittelmäßig. Genau dies, die literarische Suche, die Irrungen und Wirrungen des jungen Dichters, interessieren die Romanautorin Ersi Sotiropoulos. Was mich, und ich glaube uns alle, fasziniert, ist die Frage, wie ein Künstler (…), vom Typ her wohl eher scheu, unterdrückt in seinem Privatleben und gequält von Widersprüchen und inneren Zweifeln (…), diesen Sprung geschafft hat. Wie wird er zu dem Kavafis, den wir kennen? Quelle: Ersi Sotiropoulos – Was bleibt von der Nacht Kavafis in Paris – ein rauschhaftes Schlüsselerlebnis In „Was bleibt von der Nacht“ imaginiert sie Kavafis Paris-Aufenthalt als rauschhaftes Schlüsselerlebnis für seine künstlerische und auch für seine persönliche Entwicklung. Sie beschreibt, wie der Grieche aus dem provinziellen Alexandria durch die Straßen der pulsierenden französischen Hauptstadt streift und sich in ihnen verliert, wie dabei äußere Eindrücke und Kavafis komplexe Innenwelten immer wieder verschwimmen: Innenwelten, die von unfertigen Versen, Kindheits-Erinnerungen und erotischen Fantasien bevölkert sind. Zwar schreibt Sotiropoulos über den Dichter in der dritten Person, aber sie schaut nicht von außen auf ihn, sondern nimmt seine Perspektive ein. Eine Locke des jungen Tänzers war über die Rückenlehne des Sessels geglitten. Weiches, frisch gewaschenes Haar mit hell schimmernden Strähnen. Und da war so etwas wie ein Duft, himmlisch, der hin und wieder zu ihm herüberwehte. (…) Er atmete tief ein und schloss die Augen. Ein Duft nach Milch und frischem Getreide. Quelle: Ersi Sotiropoulos – Was bleibt von der Nacht Schaffensdrang und Selbstzweifel Konstantinos Kavafis homosexuelles Begehren zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman. Die Autorin schildert es als intensive und unausgelebte Leidenschaft, die den Lyriker mal beglückt, mal an den Rand des Wahnsinns treibt. Später wird es Kavafis gelingen, über sein erotisches Begehren zu schreiben – ja, dieses wird zu einer treibenden Kraft für seine Poesie. Das Schwanken zwischen überbordendem Schaffensdrang und quälenden Selbstzweifeln, das verzweifelte Ringen um eine eigene literarische Stimme – Ersi Sotiropoulos Darstellung der inneren Kämpfe des Dichters ist durchaus überzeugend: Verfluchte Adjektive, dachte er. Verfluchter Reim. Etwas früher war ihm der Gedanke gekommen, dass diese ganzen Schwierigkeiten beim Schreiben vielleicht gar nicht vom Schreiben selbst herrührten. Vielleicht war es ein ihm eigenes, ein inneres Problem. Dieses starke Bedürfnis nach einem Bruch in seiner Dichtung (…), dieser irrationale Drang, die Regeln zu verletzen (…), sich von den Lyrismen und der überladenen Sprache zu befreien. Quelle: Ersi Sotiropoulos – Was bleibt von der Nacht Meisterhafte Beschreibung von Menschen und Orten So wird in dem Roman Kavafis Blitzbesuch in Paris zu einem Befreiungsschlag und das Jahr 1897 zu einem Wendepunkt in seinem künstlerischen und persönlichen Werdegang. Konstantinos Kavafis hat nichts Schriftliches über jene Tage hinterlassen – aber Ersi Sotiropoulos ist eine originelle und tiefschürfende Fiktionalisierung gelungen. Sie nähert sich der Person des Dichters mit so viel Einfühlungsvermögen, Empathie und Kenntnis seines Werks, dass sie das Interesse der Lesenden weckt. Darüber hinaus lässt die Autorin durch ihre meisterhafte Beschreibung von Menschen und Orten das Paris des fin de siècle aufleben, mit seiner Atmosphäre von Lebensfreude, Hedonismus, Frivolität und Dekadenz. Auch deshalb ist „Was bleibt von der Nacht“ ein lesenswertes und reizvolles Buch.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Fans auf der falschen Seite – Bilder von Carl Weisgerber waren bei den Nazis beliebt 3:16
3:16  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked3:16
Liked3:16
So waren Bilder Weisgerbers auf den großen Ausstellungen zwischen 1938 und 1944 zu sehen; Adolf Hitler selbst hat Werke ankaufen lassen. Wie Carl Weisgerber zu den Nationalsozialisten stand, ist nicht bekannt. Was bedeutet diese Gemengelage für seine Kunstwerke heute?
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Inklusiver Theaterabend am Schauspiel Stuttgart: „Schichtwechsel“ 3:41
3:41  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked3:41
Liked3:41
Sie lernen dabei aufeinander zuzugehen und gegenseitige Fähigkeiten zu entdecken. „Schichtwechsel“ ist ein mitreißender und witziger Abend, der von Themen wie Überforderung, Einsamkeit oder der Endlichkeit des Lebens erzählt. Aber auch davon, wie die unterschiedlichsten Formen der Ausgrenzung aussehen können.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 „Rote Sterne überm Feld“ – Aufregendes Filmdebüt von Laura Laabs 4:11
4:11  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked4:11
Liked4:11
Einer der schönsten Filme des deutschen Kinojahres Der spektakuläre Auftakt, der früh bezaubert, lässt sofort an Alexander Kluges und Jean Luc Godards Montagefilme denken und signalisiert, dass man es hier nicht mit gewöhnlichem deutschem Kino zu tun hat. Es schwebt wieder ein Engel über Berlin, ganz zu Beginn dieses Films. Es muss der Engel der Geschichte sein, denn er spricht, abwechselnd mit den Stimmen einer Frau und eines kleinen Mädchens, die berühmten Zeilen aus Walter Benjamins Thesen „Über den Begriff der Geschichte“: Dazu sehen wir ein paar zentrale Begriffe in Neonschrift zu einem langsamen Flug über das Berlin von heute. Ein Auftakt, der das Niveau anzeigt, das dieser mit dem Max-Ophüls-Preis der Filmkritik ausgezeichnete Film nie verlassen wird. Und doch bricht er das Niveau ironisch, setzt Zeichen für Humor und Unterhaltung und gibt seinem Publikum von Anfang an das Gefühl, einem Film sich anvertrauen zu können, der es ruhig und sicher bei der Hand nimmt – so wie ein Engel seine Schutzbefohlenen. Die linke Aktivistin Tine kehrt nach Bad Kleinen zurück Gleich darauf kommt der Film auf dem Boden der irdischen Tatsachen an. Denn nun hat alles eine sehr gradlinige, einfache Struktur: Hauptfigur Tine, eine junge Frau und linke Aktivistin, kehrt an den Ort zurück, den sie einst verließ, und wird dort mit ihrer verdrängten Vergangenheit konfrontiert – der Mutter, die einst verschwand; der Familiengeschichte –, wie zugleich mit den Gespenstern der deutschen Geschichte. Alte Briefe kommen zum Vorschein, Geheimnisse werden gelüftet, Geschichten erzählt. Eine Moorleiche wird gefunden, die Verführer-Figur des mythischen Erlkönigs taucht auf, diverse Szenen spielen auf das filmische und kulturelle Gedächtnis wie auf historische Erinnerungen an. Darum geht es hier: Um den geschichtlichen Möglichkeitssinn, die lebendigen Widersprüche im Vergangenen und um die Präsenz der Vergangenheit und ihre Möglichkeiten in der Gegenwart. Es geht um die Frage, was eigentlich dabei herauskommt, wenn man zurückblickt. Drei Zeitebenen: NS-Diktatur, DDR und Nachwendezeit Dies alles visualisiert die Regisseurin. So spielt „Rote Sterne auf dem Feld“ zu verschiedenen Zeiten: Der NS-Diktatur; der DDR und ihrer Abwicklung nach der Wende 89/90, der RAF, deren Mitglieder zum Teil im Osten neue Identitäten bekamen, sowie der Gegenwart, aus der auf all dies zurückgeblickt wird. Tine fungiert dabei auch als eine Art Führerin des Publikums durch diese verschiedenen Zeiten. Jedes Mal fragt sie nach Gerechtigkeit und nach den Möglichkeiten der Veränderung. Kampf um die LPG Glücksstern Die vielleicht interessanteste Episode ereignet sich zwischen 1990 und 1993: Zur Erbmasse der DDR gehören auch die LPGs. landwirtschaftliche Genossenschaften, die den neuen Herren ein Dorn im Auge sind. Der Leiter der örtlichen LPG will bei der Abwicklung nicht mitmachen und formiert Widerstand. Warum soll man auch die eigenen Tomatenfelder stilllegen, um dann holländische Tomaten im neuen Westsupermarkt zu kaufen? Es ist faszinierend, wie souverän und virtuos die Regisseurin Laura Laabs all das stilistisch zusammenhält und es glückt, dass man nie die Orientierung verliert. Sehr persönlicher Film von Laabs Regisseurin Laabs wirft erstaunlich sinnvoll Einfälle aus Philosophie und Politik, Geschichte und Gegenwart, Utopie und Zeitgeist zusammen. Das Ergebnis sieht manchmal aus wie „Twin Peaks“, mal wie „Midsommar“, mal wie „Das weiße Band“. Aber es ist alles andere als ein kühl kalkulierter Pop-Zitate-Strom. Vielmehr ein gradliniger und persönlicher Film, bei dem man spürt, dass er der Regisseurin am Herzen liegt, und so geworden ist, wie er ist, weil er so werden musste. Trailer: Rote Sterne überm Feld „Rote Sterne übermm Feld“ ist keineswegs perfekt, und nimmt doch sehr für sich ein, weil er experimentell ist und Dinge ausprobiert, sehr viele neue Einfälle hat, deren meiste gut funktionieren – und weil er anspruchsvoll ist. Dies ist endlich einmal ein deutscher Film, dem an neuen Ausdrucksformen und einem besseren Kino gelegen ist. Das Ergebnis ist ein wilder, bezaubernder Film – einer der schönsten des deutschen Kinojahres.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Norbert Elias neu gelesen: Einsamkeit der Sterbenden im 21. Jahrhundert 4:09
4:09  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked4:09
Liked4:09
Kann man den Tod austricksen? Jetzt vielleicht noch nicht, aber in naher Zukunft vermutlich schon irgendwie, zumindest eine Zeitlang. Dies glauben inzwischen nicht nur autokratische Machthaber wie Vladimir Putin und Xi Jinping, sondern eine immer größer werdende Bewegung der Schönen und Reichen. Unter dem Schlagwort „Longevity“, also Langlebigkeit , hoffen heute immer mehr Menschen, dem Tod ein Schnippchen schlagen zu können, im Vertrauen auf Fortschritte in Medizin und Wissenschaft. Gesichtslose Apparatemedizin Norbert Elias hätte diese Wiederbelebung des alten Traums von der Unsterblichkeit nicht überrascht. Tatsächlich hat der deutsch-britische Soziologe sie schon Anfang der achtziger Jahre vorhergesehen, in seinem epochalen Essay „Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen“. Darin konstatiert Elias mit nüchternem Blick, wie sehr der Tod in der modernen Gesellschaft einer kollektiven Verdrängung anheimfalle. Weshalb alles, was mit Tod und Sterben zu tun habe, von uns tunlichst tabuisiert werde. Und zwar nicht nur vor Kindern. Auch wir selbst täten alles, um nicht an unsere eigene Vergänglichkeit erinnert zu werden, und mieden etwa den Kontakt zu Sterbenden. War der Tod früher etwas Alltägliches – so alltäglich, dass die Menschen oft zuhause im Kreis ihrer Angehörigen aus dem Leben scheiden konnten –, so würden die Sterbenden in modernen Gesellschaften einer ausufernden, gesichtslosen Apparatemedizin überlassen werden. Isoliert und geräuschlos Noch nie starben Menschen so geräuschlos und hygienisch wie heute in diesen entwickelteren Gesellschaften und noch nie unter sozialen Bedingungen, die in so hohem Maße die Einsamkeit befördern. Quelle: Norbert Elias: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen Wenige Jahre nach Corona, als so viele Infizierte komplett isoliert von ihren Angehörigen in Kliniken oder Pflegeheimen sterben mussten, lesen sich Beobachtungen wie diese zwangsläufig mit ungleich größerer Betroffenheit. Die nun erschienene Neuausgabe von Norbert Elias’ Essay bietet aber auch unabhängig von den Pandemiejahren eine gute Gelegenheit, über die Haltbarkeit von Elias’ Thesen nachzudenken. Und damit auch über den Umgang mit Tod und Sterben im frühen 21. Jahrhundert. Allgegenwärtiger Tod in Medien Dieser scheint sich im Vergleich zum späten 20. doch in vielerlei Hinsicht geändert zu haben, im Guten wie im Schlechten. Stichwort Verdrängung: Wer sich dem Medienkonsum nicht komplett verweigert, wird heutzutage kaum um die Konfrontation mit dem Tod in all seinen Erscheinungsformen herumkommen. Zudem strotzt, wie Didier Eribon in seinem klugen Nachwort zur Neuausgabe richtig bemerkt, gerade unsere Gegenwartskunst nur so von Darstellungen von Alter und Sterblichkeit: von Filmen wie Michael Hanekes „Liebe“ bis zu literarischen Werken wie Helga Schuberts autobiografischer Erzählung „Der heutige Tag“ über das Leben mit ihrem pflegebedürftigen Mann bis zu seinem Tod. Vielleicht sollte man doch offener und klarer über den Tod sprechen, sei es auch dadurch, daß man aufhört, ihn als Geheimnis hinzustellen. Der Tod verbirgt kein Geheimnis. Er öffnet keine Tür. Er ist das Ende eines Menschen. Was von ihm überlebt, ist das, was er anderen Menschen gegeben hat, was in ihrer Erinnerung bleibt. Quelle: Norbert Elias: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen Sterbebegleiter ChatGPT Es ist nicht zuletzt Elias’ unbarmherziger Gesellschaftsdiagnose von 1982 zu verdanken, dass seit den späten neunziger Jahren die Hospizbewegung aufkam und einen menschenwürdigeren Umgang mit dem Sterben ermöglichte. Es sage also niemand, dass sich die Dinge nicht auch zum Besseren verändern können. Und wenn, wie Elias schreibt, der moderne Mensch Hemmungen hat, bei Besuchen bei Sterbenden die richtigen Worte zu finden – und deshalb den Besuch lieber gleich unterlässt –, so scheint auch darauf unsere Gegenwart eine Antwort zu wissen. Schließlich lassen sich schon jetzt immer mehr Menschen von den allgegenwärtigen KIs Liebes- oder Beileidsbriefe schreiben. Wenn man also gar nicht weiß, was man zu einem todkranken Angehörigen oder Freund sagen soll – ChatGPT weiß es bestimmt.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Nachhaltig und sozial: Wie das Steingauquartier ein Vorbild für Städte wird 3:55
3:55  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked3:55
Liked3:55
Hier ist kein Haus wie das andere. Schwarze Fassaden mit geschwungenen Balkonen stehen neben Holzfassaden, an denen Pflanzen hochranken. Daneben ein pistaziengrünes Gebäude, weiter hinten eines in Schwedenrot. Ein Spaziergang durchs Viertel zeigt: Hier wurde mit Mut zur Vielfalt gebaut – und mit dem Wunsch, Gemeinschaft zu leben. Die Gemeinschaft. Das ist es, was das Steingau ausmacht. Jedes Haus sieht anders aus, und in den Innenhöfen können sich die Kinder frei bewegen Quelle: Steingauquartier-Bewohner Dass das möglich wurde, liegt an einer ungewöhnlichen Entscheidung der Stadt. Kirchheim hatte das Vorkaufsrecht für das Areal genutzt und den Baugrund anschließend gezielt an Baugruppen und Investoren weitergegeben, die bereit waren, sich an soziale und städtebauliche Vorgaben zu halten. Nicht der höchste Preis zählte, sondern der beste Beitrag zur Gemeinschaft. Ein Quartier mit Anspruch Wer hier bauen wollte, musste zeigen, wie das eigene Projekt zur Stadtgesellschaft beiträgt – sei es durch besondere Wohnformen, soziale Angebote oder gemeinschaftliche Nutzungskonzepte. Eine Architektur-Jury entschied über die Bewerbungen. Wir wollten zeigen, dass nachhaltige, soziale Quartiere nicht nur in Universitätsstädten funktionieren. Quelle: Stadtplaner Gernot Pohl „Wir haben hier Projekte, die besonders vielfältige Wohnangebote gemacht haben“, erklärt Stadtplaner Gernot Pohl, Abteilungsleiter für Städtebau und Baurecht, „es gibt Penthouse- und Sozialwohnungen, Clusterwohnungen als moderne WGs, Pflege- und Demenz-Wohngemeinschaften oder auch Wohnungen, die bewusst unter Mietspiegel vermietet werden.“ Neben Wohnraum ist auch Platz für Arbeit und Begegnung entstanden. Rund 25 Gewerbebetriebe sind inzwischen im Steingau zuhause: von Arztpraxis und Fahrradanhänger-Manufaktur bis hin zu Cafés und kleinen Läden ist alles vorhanden. Es gibt Gemeinschaftsräume, eine Werkstatt fürs Quartier, Sportgruppen, Spieleabende und Krabbelgruppen. Etwa 800 Menschen leben mittlerweile hier. Ein Wohnzimmer für alle Im Herzen des Viertels liegt der neue Quartiersplatz mit Brunnen, Kletterelementen aus Naturstein und viel Grün. „Der Platz ist im Prinzip das Wohnzimmer des Viertels“, sagt Pohl. Hier treffe man sich, und rundherum entstehen nach und nach Gastronomien. Wer durch das Steingauquartier läuft, merkt schnell: Autos spielen hier kaum eine Rolle. Das gesamte Viertel ist mit hellen Steinen gepflastert, dazwischen wachsen Büsche und kleine Bäume. Nur neun Parkplätze gibt es, allerdings für die Gewerbebetriebe. Ein Vorbild für andere Städte 2018 begannen die Bauarbeiten, inzwischen sind die letzten Bauzäune gefallen. Was einst ein Experiment war, gilt heute als Modellprojekt für zukunftsfähige Stadtentwicklung. Delegationen aus dem In- und Ausland kommen regelmäßig, um sich das Konzept anzusehen. Pohl glaubt, dass der Erfolg auch anderswo möglich ist: „Wie jede Stadt ihre Themen übersetzt, muss sie selbst entscheiden. Aber das Beispiel zeigt, dass innovative Stadtviertel nicht nur in Tübingen oder Freiburg entstehen können, sondern überall, wo man es will.“ Das Steingauquartier ist ein Beweis mehr dafür, dass wenn Stadtplanung Raum für Vielfalt, Begegnung und Nachhaltigkeit lässt, entsteht ein Ort, an dem Menschen wirklich leben wollen.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Film ab! für die Französischen Filmtage Tübingen 3:50
3:50  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked3:50
Liked3:50
Außerdem gibt es einen Fokus Afrika, Diskussionen mit Filmschaffenden und viele der Filme haben auf dem Festival ihre Deutschlandpremiere. Premiere feiert auch Lisa Haußmann, die neue künstlerische Leiterin des Festivals. Sie möchte mit dem Festival neue Zielgruppen erreichen und vor allem ein ganz junges Publikum für das Kino begeistern.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 „Toxic Tantra“: Missbrauch unter dem Deckmantel der Spiritualität 6:50
6:50  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked6:50
Liked6:50
Schritt für Schritt vom Umfeld abgeschottet Eine Frau sei „in ein Tantra-Ritual hineingezogen worden, obwohl sie sich innerlich abgestoßen fühlte“, schildert Hawranek in SWR Kultur das Ergebnis ihrer Recherchen über Manipulation und Machtmissbrauch in der Yoga-Szene. Die Betroffenen würden „am Anfang mit extrem offenen Armen empfangen werden“ und sich dadurch sicher und besonders fühlen. Doch Schritt für Schritt würden sie „von ihrem Umfeld abgeschottet“ und immer stärker kontrolliert.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Freiheitsdichter Friedrich Schiller – Neue Dauerausstellung im renovierten Schiller-Nationalmuseum Marbach 4:08
4:08  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked4:08
Liked4:08
Schiller ging es um die gesamte Menschheit Es sind neun schmale lange Räume, nicht viel größer als ein Wohnzimmer, in denen sich die Dauerausstellung unspektakulär, aber durch Farbgebung und klare Linienführung ästhetisch sehr gelungen präsentiert. Die Botschaft hinter diesem reduzierten Auftritt: Schiller nicht überhöhen zu wollen. „Schiller hatte große Ansprüche und ganz sicher zielte er darauf, einer der ganz großen Dichter in deutscher Sprache zu werden“, sagt die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra Richter. „Aber zugleich ging es um den ganzen Erdball, den Menschen schlechthin. Dass er auf Deutsch schrieb, war historisch bloß zufällig. Er zielte auf etwas viel Größeres.“ Wir lernen immer etwas Neues, wenn wir Schiller lesen und das weiß jeder, der das mal getan hat. Wenn man diese Texte genau anschaut, dann entfaltet sich immer eine neue Bedeutungsebene Quelle: Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach im SWR Kultur Forum Sehnsucht nach gleichberechtigter Gesellschaft Dieses Größere, die Sehnsucht nach einer gleichberechtigten Gesellschaft, manifestiert sich zum Beispiel in der Ode „ An die Freude “, in der Schiller die Zeile „Alle Menschen werden Brüder“ formuliert. Der politische Denker steht im Fokus dieser Ausstellung, die sich explizit nicht chronologisch an Leben und Werk Schillers entlanghangelt. Es gibt neun Räume mit neun Kapiteln. In jedem dieser Kapitel stehe ein Objekt zentral, sagt Vera Hildenbrandt, die Leiterin der Marbacher Museen. „In dem Kapitel, das sich mit seinem politischen Denken auseinandersetzt, ist es zum Beispiel der Brief, mit dem er die französische Ehrenbürgerwürde bekommt.“ Schillers Einsatz für Freiheit ist der rote Faden Der Bogen reicht vom jungen Studenten über den Dramaturgen und Wissenschaftler bis zum literarischen Netzwerker und der Kultfigur Schiller. Er gilt als Freiheitsdichter schlechthin, weshalb sich die Frage nach Schillers Freiheits- und Gerechtigkeitsverständnis wie ein roter Faden durch alle Kapitel der Ausstellung zieht. Und es sind ganz klar die Exponate, die hier ihren stilvollen Auftritt bekommen: wertvolle Manuskripte, alte Briefe, ungewöhnliche Dokumente wie eben die Urkunde, mit der Schiller die französische Ehrenbürgerwürde verliehen wurde. Unterzeichnet von einem der führenden Köpfe der französischen Revolution, von Danton. Goethe kam ja aus wohlhabenderen Verhältnissen, Schiller war da sicherlich der, sagen wir, liberalere Geist. Derjenige, der eher auf der Seite der Freiheit stand, der durchaus Manifeste der Revolutionäre mit veröffentlicht hat, wenn er sie auch nicht selbst geschrieben hat. Quelle: Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach im SWR Kultur Forum Exponate schlagen Brücke zur Gegenwart Freiheit bedeutet ganz praktisch aber auch finanzielle Unabhängigkeit, weshalb in der Ausstellung ein stets klammer Schiller sichtbar wird, der seinen Verleger Cotta um Vorschüsse bitten muss. Der Dichter Hugo von Hofmannsthal ist da schon viel weiter: 1923 investiert er 3000 Mark in Deutsche-Petroleum-Aktien. Die Quittung ist in einer der kleinen Wechselvitrinen zu sehen, die in jedem Raum mit immer neuen Exponaten bespielt werden und die die Brücke zu Zeitgenossen Schillers oder bis ins Heute zu schlagen versuchen. Verehrung des Dichters hat kuriose Züge Natürlich ist auch Platz in dieser Ausstellung für die zuweilen recht kuriose Verehrung des Dichters. Aus einer kleinen braunen Pappschachtel, die erst 2022 per Post nach Marbach kam, quillt ein dicker Haarzopf. Wahrscheinlich von Schiller, vermutete die Einsenderin, was Helmuth Mojem bezweifelt: „Es ist ziemlich sicher nicht Schillers Haar, aber es wurde ihm zugeschrieben, so der Leiter des Cotta-Archivs. „Diesen Andenkenkult zeigen wir hier ein bisschen augenzwinkernd. Auch das ist eine Reliquie, die überliefernswert ist.“ Man wird dem Autor gerecht, indem man ihn mit seinen Aussagen und seinen Texten ernst nimmt und nicht, indem man ihn nachbetet, als wäre es die Bibel. Quelle: Jan-Christoph Gockel, Theater- und Filmregisseur (u.a. „Wallenstein“ an den Münchner Kammerspielen)…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Comic-Biografie zum 100. Geburtstag: „Die Knef“ von Moritz Stetter 4:09
4:09  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked4:09
Liked4:09
Adam und Eva im Paradies, ein Menschenaffe, Leonardo da Vincis berühmter Darstellung von der Harmonie zwischen Mensch und Kosmos. Irritierend rätselhaft ist der Auftakt dieser Graphic Novel. Moritz Stetter überrascht mit farbenfrohen Bildern. Dann plötzlich Szenen im schrillen Pink und Rot. Hitler schreit, die Massen marschieren im Gleichschritt. Das scheint nur auf den ersten Blick grotesk, denn wir sind bereits mitten drin in einem Lied von Hildegard Knef: „Es hat alles einen Anfang“. Fast ausschließlich Knefs eigene Texte Für seinen Comic hat Moritz Stetter fast ausschließlich mit Originaltexten und Zitaten von Hildegard Knef gearbeitet und sich dabei hauptsächlich auf „Der geschenkte Gaul“, den autobiografischen Roman der Künstlerin, berufen. Eine wichtige Quelle, auch wenn sich Stetter bewusst ist, dass dieser in Sachen Wahrheitsgehalt mit Vorsicht zu genießen ist. „Es ist wenig Text von mir selbst“, sagt Stetter über seine Graphic Novel. „Ich habe dann versucht, erst einmal mit diesen Texten zu arbeiten, bis ich an dem Punkt war, dass ich diesen Sound und diese Sprache so aufgenommen habe, dass ich selbst einigermaßen glaubhaft in diesem Sprachduktus schreiben konnte.“ Sogar die Handschrift der Knef wurde für eine kleine Passage nachempfunden, in der sie ihrer Mutter in einem Brief über ihre Erlebnisse in russischer Kriegsgefangenschaft berichtet. „Ich wollte ihr kein Podest bauen“ Die künstlerische Arbeit bei dieser Graphic Novel liegt einerseits in Auswahl und Collage des Textmaterials, vor allem aber in der Gestaltung. In der Wucht der Bilder, mit denen Moritz Stetter den Werdegang Hildegard Knefs darstellt. Und das hat Klasse. „Ich wollte ihr jetzt auch kein Podest bauen, das haben schon viele Biograf*innen gemacht“, erklärt Stetter seine Motivation für das Projekt. „Auf der anderen Seite wurde sie auch sehr ungerecht behandelt in der Rezeption in den Jahrzehnten nach ihrem Tod. Auch als Frau wurde sie anders behandelt als das bei Männern stattfand.“ Einblicke wie aus dem Fotoalbum der Knef Im Nachkriegsfilm „Die Sünderin“ ist Hildegard Knef ein paar Sekunden nackt zu sehen, ganz Deutschland gerät in Aufruhr. „Ich habe gedacht, ich habe das Land zerrissen oder bombardiert“, kommentiert die Schauspielerin später. „Dieses alberne Melodrama wurde zu einem Skandal. Lächerlich.“ Moritz Stetter zeichnet die Vielgescholtene als gigantisches Monster in lila Giftfarben, das über den Protest der Kirchen und wohlfeilen Bürger hinweg die Städte zertrampelt. Auch wenn sich der Künstler um Ausgewogenheit bemüht – seine Sympathie für den Menschen Hildegard Knef wird in seinen Illustrationen sichtbar, die sich extrem verändern und eine unglaubliche Dynamik entwickeln. Mal blättert man wie in einem Fotoalbum und schaut dem kleinen Hildchen beim Aufwachsen zu. Dann Szenen aus dem Berlin der 1930er-Jahre, die jüdischen Nachbarn verschwinden. Dann eine Interviewszene mit der Knef, die von den Anfängen ihrer Schauspielkarriere erzählt. Und wieder ein Schnitt: die Knef in Großaufnahme über eine ganze Seite gezeichnet. Moritz Stetter lässt rote Rosen regnen Von nun an geht’s bergab – diese Liedzeile zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Graphic Novel. Aus dem Dunkel der Nachkriegszeit in Deutschland startet die Knef in ein hellgelbes Hollywood. Farben und Formate der Bilder wechseln ständig und kommentieren auf subtile Weise das Geschehen, an das Moritz Stetter durch seine eigenwillige Darstellung immer wieder mal ein Fragezeichen setzt. Unglaublich auch, dass man durch die vielen Liedtexte in diesem Comic schon fast meint, die Knef singen zu hören. Und natürlich lässt Moritz Stetter in seiner Hommage die Rosen regnen: „Ich find die Lieder unfassbar und zeitlos. Ich habe so einen Playlist mit meinen 30 Lieblingsliedern“, sagt der Zeichner und Autor. „Ich finde ihre Musikkarriere fast die Spannendste und die Unsterblichste.“…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Unterwasser-Archäologen suchen in der Mosel nach römischen Brücken 10:44
10:44  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked10:44
Liked10:44
Trier war einst Hauptstadt der westlichen römischen Provinzen. Dort haben die Römer Handel betrieben, auch mit Schiffen auf der Mosel. Doch wo genau lagen die antiken Häfen und Brücken? Und wie findet man mögliche Überreste im schlammigen Flussbett? Dazu arbeitet der Unterwasser-Archäologe Max Fiederling vom Trierer Transmare-Institut. Mit modernsten Sonargeräten tastete er mit Kollegen das Flussbett der Mosel ab.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Kulinarische Weltreise: Die Ausstellung „Aufgetischt“ zeigt Tischgedecke aus aller Welt 3:53
3:53  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked3:53
Liked3:53
Die Idee zur Ausstellung „Aufgetischt – eine kulinarische Weltreise“ lieferte ein Taschenmesser aus der Römerzeit, das auf einer Postkarte abgebildet war und bei Co-Kuratorin Isabel Schmidt-Mappes im Briefkasten landete. „Die flatterte eines Tages ins Haus, wir hatten schon die Idee generell mal was zum Thema Tischkultur zu machen und dann kam die Postkarte und irgendwie hat die das Ganze nochmal befeuert und inspiriert.“ Quelle: Isabel Schmidt-Mappes, Co-Kuratorin der Ausstellung Taschenmesser aus der Römerzeit Das Taschenmesser sieht noch nicht ganz so aus, wie die, die wir von heute kennen – aber fast. An einem geschwungenen Griff aus Silber sind ein Messer, eine Gabel, ein Löffel und andere kleine Werkzeuge befestigt, die man ein- und ausklappen kann. Das antike Klappmesser ist eine Leihgabe des Universitätsmuseums Cambridge und nicht nur eines der Highlights der Pforzheimer Ausstellung, sondern auch ein Beleg dafür, dass Essen immer schon über die bloße Nahrungsaufnahme hinausging, erläutert Museumsleiterin Friederike Zobel. Denn ein geschmückter Tisch ist auch immer Ausdruck für eine Wertschätzung des Essens. Seitdem es Menschen gibt, die sich zusammensetzen und das Essen gemeinsam genießen, wurde auch immer für den entsprechenden Tischschmuck gesorgt – auch für eine gewisse Sinnlichkeit der Behältnisse, die zeigen, wie wertvoll Essen immer schon war. Das Essen hat also auch das Umfeld gestaltet. Quelle: Friederike Zobel, Leiterin des Schmuckmuseums Pforzheim Wertschätzung des Essens durch Tischdekoration Zobel geht sogar noch einen Schritt weiter und meint, es sei sogar wichtiger, das Essen schön anzurichten und den Tisch zu dekorieren, als sich schick gekleidet an den Tisch zu setzen, um dem Essen, unserem Lebenselexier die nötige Wertschätzung entgegenzubringen. Viele Aspekte unserer Tischkultur haben wir uns in den letzten Jahrhunderten aus anderen Kulturen angeeignet. Durch Handel, Eroberungszüge und Migrationsprozesse gelangte eine immer größere Vielfalt an Nahrungsmitteln auf unseren Speiseplan. Geringe Ess- und Tischkultur im Mittelalter Während das Mittelalter von einer sehr spärlichen, grobmotorischen Esskultur geprägt war, sind die Mauren für die Verfeinerung der Speisen durch Gewürze unterschiedlichster Kontinente verantwortlich. Auch die Tischsitten und das genussvolle Zelebrieren des Essens ist auf den nordafrikanischen Bevölkerungsstamm zurückgeführt. So wurden Speisen dekorativ angerichtet und in Form eines mehrgängigen Menüs serviert. Barockzeit inszeniert Essen und Tafeln zum Gesamtkunstwerk In der Barockzeit wurde die Tafel zum Gesamtkunstwerk. Dazu gehörte auch die Inszenierung des Services sowie der Speisen an sich. Da das Besteck zu Essenseinladungen mitgebracht wurde, waren aufwendige Gestaltungen von Messer und Gabel üblich – schließlich sollte das Besteck rasch wiedererkannt werden. Ebenso war es nicht en vogue, mehr Besteck als nötig zu besitzen. So gab es im Mittelalter selbst in Gaststätten kein Besteck zur Mahlzeit dazu – jeder hatte nur eine eigene Garnitur. Und es galt: je prunkvoller, desto reicher war die Person. Sinn für Ästhetik nimmt im Laufe der Jahrtausende zunächst zu Besonders deutlich wird der wachsende Sinn für Ästhetik auch in der musealen Anordnung der Exponate. Diese sind in den Vitrinen nämlich nicht chronologisch geordnet, sondern nach Formen – und das hat einen ganz besonderen Grund, wie Kuratorin Katja Poljanac am Beispiel von Trinkgefäßen erklärt: Es geht um den Essensvorgang. Daraufhin werden die Gefäße verziert und etwa als Becher oder Flasche benutzt. Verwendet werden beispielsweise Naturmaterialien wie Kokosnuss oder Kalebasse. Quelle: Katja Poljanac, Kuratorin der Ausstellung Von der Wegwerfgesellschaft zurück zum Essen am runden Tisch? Eine entscheidende Rolle hat aber auch der technologische Fortschritt gespielt, mit dem Geschirr aus Porzellan, Metalllegierungen und nicht zuletzt aus Plastik und als Massenware hergestellt werden konnte. Aus diesem Grund setzt sich die Ausstellung auch mit der Wegwerfgesellschaft auseinander, die unsere Tischkultur heutzutage prägt. Dabei sind auch Fast Food und To-Go-Gerichte nicht ganz unschuldig. In einer Vitrine ist beispielsweise eine leere Croissant-Tüte, die einer Papiertüte täuschend ähnlich sieht, ausgestellt. Sie wurde aber nicht achtlos weggeworfen, sondern 2016 vom Schweizer Schmuckkünstler David Bielander aus patiniertem Silber gefertigt. Mittlerweile beobachtet die Museumsleiterin aber auch wieder ein Umdenken, sodass wieder nachhaltiger mit „Wegwerf-Geschirr“ umgegangen wird und auch dem gemeinsamen Essen wieder eine größere Bedeutung zukommt. Ausstellung „Aufgetischt – eine kulinarische Weltreise“ bietet Interaktives Wer nun noch erfahren möchte, was damals und in anderen Kulturen tatsächlich auf den Tisch kam, kann interaktiv auf historische Rezepte zugreifen. Ebenso ist es möglich, sich über unterschiedliche Rezepte gegenseitig auszutauschen.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
Zugabteile sind bevorzugte Handlungsorte für den Erzähler Sten Nadolny. Das galt für sein Debüt „Netzkarte“ von 1981 ebenso wie zehn Jahre später für „Selim oder die Gabe der Rede“. Auch der neue Roman des inzwischen 83-jährigen beginnt mit einer Zugfahrt. Zwei alte Schulfreunde – der zögerliche, sich für „hochsensibel“ haltende Schriftsteller Michael und der polternde, bajuwarisch unerschrockene Theaterregisseur Bruno – reisen im Jahr 1998 von Düsseldorf nach Zürich. Unterwegs lernen sie eine wunderschöne junge Frau kennen, so klug wie geheimnisvoll. Als Michael saß, konnte er sie betrachten. Stockhübsch, dachte er – das war sein Ausdruck für Frauen, die er schön fand. Aber da war noch etwas anderes. Diese Art Gesicht meinte er von einem alten Porträt her zu kennen und suchte im Gedächtnis vergeblich nach dem Maler. Einer der Cranachs vielleicht, aber hatten die jemals eine dunkelhaarige Frau gemalt? Quelle: Sten Nadolny – Herbstgeschichte Damit ist ein zentrales Motiv eingeführt: Gesichter und das genaue Hinsehen. Während der Schriftsteller Michael darunter leidet, sich keine Gesichter merken zu können, besitzt die junge Frau, die sich Marietta Robusti nennt, ein außerordentliches visuelles Gedächtnis. Sie erkennt auch die beiden semiprominenten Mitreisenden sofort. Sie hat kein Geld, wird verfolgt oder überwacht, so dass die beiden Männer beschließen, ihr zu helfen. Gibt es selbstlose Hilfe? Erzählt wird dieser Auftakt von einem dritten Schulfreund, Titus, einem Drehbuchautor. Er begegnet – und davon erzählt er im zweiten Kapitel – Michael auf einer Kreuzfahrt im Sommer 2024. Michael zieht ihn in seine Geschichte mit Marietta hinein, die er vier Jahre nach der ersten Begegnung im Zug auf einer Lesereise wiedertraf, ohne sie sofort zu erkennen. Denn sie saß nun im Rollstuhl. Von sexuellen Übergriffen in ihrer Jugend schwer traumatisiert und von einer rätselhaften Krankheit gelähmt, brauchte sie nun Hilfe ganz anderer Art. Doch auch Marietta selbst versteht sich als Helferin, weil sie mit ihren scharfen Augen alles wahrnimmt, was um sie herum passiert. Ich helfe, weil ich, wenn ich hingesehen habe, nicht wieder wegsehen kann. Und weil ich dann das tun muss, was sich richtig anfühlt. Und weil Nichtstun sich meistens falsch anfühlt. Quelle: Sten Nadolny – Herbstgeschichte Michael wird zu ihrem Vertrauten, Begleiter, väterlichen Freund. Doch scheitert er daran, den Stoff „Frau im Rollstuhl“ zum Roman zu verdichten. Was wäre auch das Thema? Etwa die Frage, ob es reine, selbstlose Hilfe überhaupt gibt? Also bittet er Titus darum, sich der Sache anzunehmen, auch wenn am Ende kein Drehbuch daraus wird, sondern ein Roman – ganz so, wie es einst bei Nadolnys Debüt „Netzkarte“ gewesen ist. Erzählen als Teppichknüpfen Auch das Operieren mit Herausgeber- oder wie in diesem Fall einer Schriftstellerfiktion ist bei Nadolny nicht neu, wie er überhaupt für seine „Herbstgeschichte“ viele Fäden seines Werkes wieder aufgenommen und neu verwoben hat. Fäden der Fiktion „Herbstgeschichte“ lebt vor allem von der sorgfältig ausgetüftelten Konstruktion, vielleicht auch von der Spannung, weil man wissen will, was mit Marietta geschehen ist und ob es für sie eine Rettung gibt. Darauf darf man hoffen, weil Nadolny als Erzähler gerne verschiedene Möglichkeiten anbietet und es seinen Lesern überlässt, aus den Fäden der Fiktion ihre eigene Wahrheit zu weben. Weniger geglückt sind die etwas hölzernen Dialoge, die leicht verschmockten Altherrenfiguren und die allzu geflissentlich eingearbeiteten politischen Gegenwartsbezüge. Aufgewogen wird das aber durch den erzählerischen Charme Nadolnys und seine Menschenfreundlichkeit, die aus jedem noch so tragischen Ereignis das Beste herauszuholen vermag.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Eröffnung der DOK Leipzig – Durch andere Augen 7:58
7:58  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked7:58
Liked7:58
Mit dabei sind in diesem Jahr viele Filme über Klima, Tiere und private Geschichten, so SWR Kultur Filmexperte Rüdiger Suchsland. Den Eröffnungsfilm „Writing Life: Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students“ von Claire Simon bewertet er als „einen sehr schönen, ein optimistischen Film“. Simon führe die Zuschauer aber auch hinters Licht. Namensgeberin Annie Ernaux ist im Film nicht zu sehen. „Es geht um sie, aber wir sehen sie nicht ein einziges Mal. Auch nicht als Foto oder so, weil es eigentlich, eben wörtlich betrachtet, durch die Augen der Gymnasialschüler geht.“ Letzte Festivalausgabe für Christoph Terhechte Der Leiter des Festivals Christoph Terhechte beendet nach der sechsten Ausgabe seine Tätigkeit aus privaten Gründen. Er habe das Festival in Zeiten von Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine und Inflation wieder „aufs Gleis gestellt“, findet Suchsland. In einem Plädoyer hat Terhechte sich noch einmal für die Kulturpolitik und für die Bedeutung von Kultur ausgesprochen. Das Plädoyer habe sich auch an den Freistaat Sachsen gerichtet. Suchsland: „Letztes Jahr war das Festival von massiven Kürzungen bedroht. Die wurden dann zurückgenommen, auch weil er öffentlich getrommelt hat.“…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Universität Mainz verleiht Gutenberg-Zukunfts-Award an Lea Dohm 7:43
7:43  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked7:43
Liked7:43
Wer möchte bei den ganzen schlimmen Nachrichten von Krisen, Kriegen und Klimawandel nicht lieber den Kopf in den Sand stecken? Verdrängen, weil man sich gelähmt fühlt. Dagegen arbeitet die Psychologin und Sozialwissenschaftlerin Lea Dohm an. Sie plädiert dafür, die kleinen Handlungsmöglichkeiten, die jeder von uns hat, wahrzunehmen. Für ihren Ansatz wird sie zusammen mit dem Arzt und Wissenschaftsjournalisten Eckart von Hirschhausen mit dem Gutenberg-Zukunfts-Award der Universität Mainz ausgezeichnet.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Der zerbrochne Krug - Viel gewollt, wenig erreicht 4:17
4:17  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked4:17
Liked4:17
Die Frage nach dem Warum Eve hat ihre Freundinnen zur Pyjama-Party geladen. Von Anfang an übernimmt die junge Frau, die im Originaltext bei Kleist kaum zu Wort kommt, selbstbewusst die Regie, die Freundinnen sollen die Rollen aus dem Schauspiel übernehmen. Auf dem Shirt einer Spielerin steht „Swan Lake“; aber eine andere tanzt als Ballerina über die Bühne; Laura Palacios soll den Part des Richters Adam übernehmen und trägt ein rosa Negligé. Sehr unpassend für die Richterrolle, warum trägt sie das? Achtung, Spoiler: Wenn man anfängt, sich die nach Frage nach dem „Warum“ zu stellen, kann man den ganzen Abend nicht mehr damit aufhören. Kleists Stoff stammt von Anfang des 19. Jahrhunderts Kleist hat mit poetischer Kraft das Stück über die Gerichtsverhandlung Anfang des 19. Jahrhundert geschrieben. Die Mutter, gespielt von Anja Schweitzer, klagt an: Wer hat sich nachts in die Kammer von Eve geschlichen? Nicht der Verlobte Ruprecht war es, sondern Richter Adam. Der windet sich und wird zur Karikatur seiner selbst. So entlarvt Kleist im Original unterhaltsam das Machtgefüge. Ratlosigkeit an vielen Stellen Nun also der feministische Ansatz: Eve soll sich selbst ermächtigen, auf der Bühne mit dem Bett aus weißen Rüschen und Satin, auf dem rumgehopst wird und unter dem sich die Akteurinnen immer mal wieder verkriechen, wenn sie sich nicht in die weißen Riesen-Teddys am Rand der Bühne fallen lassen. Hinter Schlafgemach und Tüllvorhang rieselt den ganzen Abend lang Schnee vom Himmel, man fragt sich wieder: warum? Und: Warum zählt Hale Richter alias Ruprecht auf der Bühne bis 100 oder noch weiter, wie beim kindlichen Versteckspiel, wo wir doch im Schlafzimmer von offensichtlich erwachsenen Frauen sind? Man kann kaum folgen Eines glaubt man zu verstehen: Es gibt keinen Krug, der zerbrochen wurde. Stattdessen werden die Teddybären über die Bühne geschleift, offensichtlich ein Symbol für eine verlorene Kindheit. Fragen über Fragen, aber das Wichtigste ist: Wie soll man dem ganzen Theater inhaltlich folgen können? Wir sehen Schauspielende – die in mädchenhafter Nachtkleidung Schauspieler spielen, die in einem Gerichtssaal agieren sollen, um dann immer mal wieder zu jungen Frauen oder Mädchen zu werden – mindestens ein Twist zu viel. Zerstückelung des Originals bis zur Unkenntlichkeit Der Text von Kleist wird bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt und verliert seine Kraft. Das Schlafzimmer bleibt durchgehend die Kulisse, auch das Bühnenbild hilft nicht weiter. Noch dazu sind die Akteurinnen mit drahtlosen Mikrophonen ausgestattet und sind immer wieder, auch akustisch, nur schwer zu verstehen. Vielleicht wollte die Regisseurin auch gar nicht, dass man zu viel versteht. Vielleicht reicht es ja, wenn man sich eine Bedrohung vermittelt, das unterstreichen die Lichteffekte, die immer greller werden und der immer härter werdende Sound. Gute Idee, schlechte Umsetzung Zum Schluss hat Eve den Richter in die Ecke gedrängt und ist ihm plötzlich überlegen. Auch das unterscheidet sich vom Original, denn in der Vorlage gewinnt die Obrigkeit. Die Regisseurin verteilt Blumen, das Publikum verlässt ratlos den Saal. Die Idee, den Kleistschen Stoff feministisch zu übersetzen ist gut und wichtig, in der Umsetzung ist die Inszenierung aber leider in fast jeder Hinsicht schwer verständlich. Am besten bedient ist man vielleicht, wenn man es so macht wie die Abiturientinnen und Abiturienten im Land („Der zerbrochene Krug“ ist nämlich Pflichtlektüre): Erst Kleist lesen und verstehen und dann ins Freiburger Theater gehen. Die Inszenierung wird sicher für reichlich Gesprächsstoff sorgen.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 La.Meko 2025: Internationales Kurzfilmfestival in Landau feiert 20. Jubiläum 3:37
3:37  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked3:37
Liked3:37
Zum 20. Jubiläum zeigt das internationale Kurzfilmfestival „La.Meko“ in Landau wieder kreative Filmschätze aus aller Welt – schräge Komödien, berührende Dramen und überraschende Animationen. Wer gewinnt? Das entscheidet das Publikum selbst! Ein Blick hinter die Kulissen des Festivals voller Herzblut, internationalen Begegnungen und handgemachter Kino-Magie.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Ein beeindruckendes Buch: Peter Wawerzineks „Rom sehen und nicht sterben“ 4:09
4:09  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked4:09
Liked4:09
Es beginnt mit einem Höhenflug. Fasziniert beobachtet der Ich-Erzähler, der Peter Wawerzinek wieder zum Verwechseln ähnlich sieht, die Flugkünste der Stare über der Stadt Rom. Eine gute Zeit scheint anzubrechen. Ein Stipendium in der Villa Massimo wurde dem Schriftsteller zugesprochen. Aber auf den letzten Metern dorthin erleidet er einen ersten Schwächeanfall. Bald gibt es weitere Vorzeichen für kommendes Unheil: den Totalverlust eines Manuskripts und schließlich ein scheußliches Frieren mitten im Sommer. Wawerzinek ruft seinen Arzt in Berlin an, der zu einer schnellen Untersuchung drängt. Die bestürzende Diagnose: Krebs. Beherberge neuerdings einen Mörder in mir. Hat sich feige in meinem Magen eingenistet. Frisst von meinem Fleisch. Trinkt von meinem Blut. Quelle: Peter Wawerzinek – Rom sehen und nicht sterben Hausfriedensbruch im eigenen Körper Für die Chemotherapie und die Operation kehrt er „inkognito“ nach Berlin zurück, verkriecht sich in einer Einzimmerwohnung, um sich ganz auf sich selbst und den „Hausfriedensbruch“ in seinem Körper zu konzentrieren. „Rom sehen und nicht sterben“ ist ein literarischer Abwehrzauber gegen den Tod, der nicht zum ersten Mal mit einladender Geste auf Wawerzinek zukommt. Seit Kindertagen gab es immer wieder lebensgefährliche Unfälle und Desaster. Und so hofft er, dem Tod auch diesmal von der Schippe zu springen. Sein Roman ist das Überlebensbuch eines Menschen, der aus vielem Kraft schöpft – dem Jazz, der Natur und vor allem aus der Sprache, der Poesie und einer Fabulierlust, mit der sich die bittere Realität entschärfen lässt. Setze den unerwünschten Begriff vor die Tür. Spreche ihm die Allmacht ab. Breche ihm die Klauen. Beschert mir weniger beängstigende Gedanken, sage ich Krätz zum Krebsgeschwür in mir. (…) Erweitere die Verniedlichungsform. Sage gar Min Schietkrätz, um das Übel somit, dreifach am Schopf genommen, zu zerstückeln. Quelle: Peter Wawerzinek – Rom sehen und nicht sterben Sich selbst singen Flugs wird auch der Stadtteil Trastevere, in dem der Schriftsteller inzwischen lebt, in „Trostwerdemir“ umgetauft. So zelebriert Wawerzinek Lautmalereien, Wortwitze und Kalauer wie die „panische Treppe“, spielt mit Märchenmotiven und Gedichtzeilen. Spannkraft bekommt seine Suada durch die vielen Ellipsen, also die Verknappung der Sätze durch das Weglassen von Wörtern. Oft fällt dabei jenes Wort unter den Tisch, das bei Wawerzinek doch über allen anderen steht: das „Ich“. Nicht zufällig zitiert er Walt Whitmans „Song of Myself“, wo es heißt: „Ich feiere mich selbst und singe mich selbst.“ Zu guter Letzt Liebe Auch Wawerzinek „singt sich selbst“, auch er ist ein literarischer Selbsterforscher, der in den eigenen Schmerz- und Glückserfahrungen die Welt erschließt. Allerdings fehlen dem Roman über die monomane Selbstdarstellung hinaus andere interessante Figuren. Es gibt drei wichtige Bezugspersonen, die aber alle etwas Gesichtsloses haben: Da ist der ominöse Briefpartner, an den sich der Text in direkter Ansprache richtet; da ist – wie ein guter Geist – die längst verstorbene Großmutter mit ihren Sprüchen und Lebensweisheiten. Und da ist zu guter Letzt die neue Partnerin, die dem Finale des Romans euphorische Momente beschert: nicht nur den Krebs überstanden, sondern an einer Bushaltestelle die Liebe auf den ersten Blick gefunden, die sich auch noch ohne Komplikationen in einen glücksdurchleuchteten Alltag überführen lässt. Aber auch diese Frau wird mehr beschworen als beschrieben, als wäre sie eine Emanation des überschwänglichen Wawerzinek-Ichs. Dennoch ist „Rom sehen und nicht sterben“ ein beeindruckendes Buch: anrührend in seiner schonungslosen Ehrlichkeit und existentiellen Tiefe, erheiternd durch den Witz und die quecksilbrige Sprachkunst. Hinzu kommen die Reize eines Rom-Reiseberichts, dessen Erzähler als „Stadtläufer“ die Zuckerstücke des Tourismus komplett ignoriert, um seinen ganz eigenen süßsauren „Romolog“ zu formulieren.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Keine romantische Erlösungsfabel: „Lohengrin“ am Nationaltheater Mannheim 6:36
6:36  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked6:36
Liked6:36
Das Nationaltheater Mannheim hat in jüngster Zeit Schlagzeilen produziert, allerdings weniger durch Künstlerisches als durch eine angespannte Haushaltslage: Die Sanierung des Haupthauses wird teurer als geplant und zwingt zum Sparen. Eine Opernproduktion musste bereits gestrichen werden. Fast schon symbolisch wirkt es nun, als neue Produktion Richard Wagners „Lohengrin“ als Oper über die Erlösung durch ein göttliches Wunder aufs Programm zu setzen. Kein Wunder, nirgends. Und Erlösung von dem Übel schon gar nicht. Keine romantische Erlösungsfabel in Mannheim Am Nationaltheater Mannheim verweigert Regisseur Roger Vontobel in seiner Inszenierung die Erlösungsutopie des Träumerischen. Und das, obwohl der die bedrängte Elsa aus einer Zwangslage befreiende Gralsritter von ihr in einem visionären Bild herbeigeträumt wird. Stattdessen zeigt die Videoprojektion Lohengrin gleich zu Beginn als einen eher beängstigenden, aus einer weißen Ursuppe erwachsenden Homunkulus mit zum Schrei geöffneten Mund. Dazu lässt Roberto Rizzi Brignoli das Orchester des Nationaltheaters Wagners magisches Vorspiel recht überdeutlich entzaubert durchbuchstabieren. Das passt zwar zu jenem aufklärerischen Lichtspiel, wonach der wunderbare Gralsritter Lohengrin eine Kopfgeburt Elsas ist, verfehlt dann aber doch einiges an Wagners musikalischen Intentionen. Naturkräfte und Hexenprozesse Doch erst einmal inszeniert Vontobel den Gerichtstag über Elsa als einen Hexenprozess, um die zerstrittene Bevölkerung von Brabant wieder zur Kriegsmasse unter König Heinrichs Führung zu einen. Fahrig, verschmutzt tritt Elsa auf und wird vom verkündenden Heerführer geradezu inquisitorisch bedrängt. Wie einige seiner Mannen ist er mit einem roten Kreuz gezeichnet, als sei der göttliche Blitz in das fleischliche Antlitz gefahren. Bei Heinrich reicht es zu vampirhaft blutumränderten Augen. Die eigentliche Hexe ist natürlich Elsas Gegenspielerin Ortrud mit anarchischer Punkfrisur. Sie vertritt die Seite der alten, heidnischen Welt, die sich noch im fragilen Einklang mit den Naturkräften befindet. Diese Welt manifestiert sich im Bühnenbild von Fabian Wendling als Wald toter, verkohlter Baumskelette. Aus dem gleichen Holz dieser Bäume schält sich im Hintergrund dann ein Blockhäuschen heraus. Es ist zunächst Zeichen des Zivilisatorischen, wird dann im zweiten Akt mit einem Licht-Tor zur Kapelle umfunktioniert. Es dient auch der recht fleischlichen Hochzeit von Elsa und ihrem Retter Lohengrin. Mannheims Lohengrin ist kein holder Schwanenritter Eigentlich ist dieser Mannheimer „Lohengrin“ das Drama der Ortrud. Sie versucht, die alten naturmagischen Verhältnisse wiederherzustellen und übt Widerstand gegen die christliche Aufklärung unter Heinrich und seinem hämisch-sadistisch dauergrinsenden Heerführer, der als Propagandist einer ziemlich kolonialistischen Unterwerfung der Friesen auftritt. Am Ende gibt es nur Verlierer: Die alte Welt lässt sich nicht überwinden und Elsa hat mit Lohengrin einen ziemlich gewalttätigen Wohltäter hervorgebracht, der sich prompt zum Heerführer gegen die ungarischen Horden machen lässt. Und da Elsa von ihrer anstrengenden Kopfgeburt genug hat, endet es ziemlich katastrophisch und unschön. Dem intriganten Ortrud-Gefährten Telramund wird von Lohengrin kurzerhand der Kopf abgeschlagen und dann auch noch präsentiert wie das Märtyrerhaupt des Jesus-Täufers in Strauss‘ „Salome“. Eine etwas seelenlose Erscheinung Dieser Lohengrin ist ohnehin eine etwas seelenlose Erscheinung. In ganz-körperlichem weißem Anstrich, der zunehmend rissiger wird, agiert er recht steif wie eine singende Statue aus einem Cocteau-Film, eher ein Alb- als ein Wunschtraum. Den von ihm am Ende befreiten Schwanenknaben, angeblich der von Elsa ermordete Bruder, zeichnen Heinrich und sein Heerführer mit roter Schminke um Augen und Mund zur Fratze neuer christlicher Führerschaft. So weit, so dekonstruktivistisch finster: Die neuen Zeiten sind eben nicht besser als die alten. Kein Fortschritt, nirgends. Preußisch laut statt klangschön Verkannt wird dabei, dass Wagners „Lohengrin“ weder das Drama des Titelhelden, noch das der Gegenspielerin Ortrud ist, sondern das der träumenden Elsa. Sie zerbricht an ihrem Wirklichkeit werdenden Traum. Der bedingungslose Glaube an das Wunder ist menschlich nicht aushaltbar. Stattdessen tritt in Mannheim die historische Rahmenhandlung als kritisch-politisches Theater ins Zentrum. Der Glaube ans Wunder ist aus machttaktischen Gründen korrumpiert. Konsequent korrumpiert sich dabei auch die Musik: Dirigent Roberto Rizzi Brignoli geht in eine Falle von Wagners Partitur. Die Holz- und Blechbläser dominieren stark und das verführt zu kraftvollen Artikulationen. Hier hat aber der Chor in seiner Massivität die meisten Opfer zu bringen. Insgesamt gerät das eher preußisch laut als klangmächtig oder gar klangschön. Dass selbst die Echoeffekte der Bühnenblechmusik durchaus elegant sein können, bleibt außen vor. Überzeugende Darbietung in den Hauptrollen Den Sängerinnen und Sängern macht es dieses dynamisch nach Oben gerichtete und tempomäßig breite Spiel nicht gerade leicht. Jonathan Stoughton singt die Titelpartie durchaus treffsicher, aber dynamisch eindimensional mit leichtem Hang zum ungewollten Wobble. Als Elsa ist Astrid Kessler sicher keine mädchenhafte Unschuld, sondern eine reflektierende Frau, die da auch an die Grenzen des träumerischen Tonfalls gerät. Darstellerisch ist sie eine perfekte Verkörperung im Sinne der Regie. Mannheims „Lohengrin“ bleibt zwiespältig Der Telramund von Joachim Goltz ist eine leidenschaftliche Explosivkraft eines Manipulierten, der von seiner Manipulation nichts weiß. Er wird zum glaubwürdigen Handelnden seiner widerständigen Gattin Ortrud, deren Rachsucht Julia Faylenbogen als kämpferische Stimme und nicht als boshafte Hexe zu gestalten vermag. Joachim Zielke ist der mächtige König, der er zu sein hat, während Nikola Diskić als propagandistischer Heerführer erstaunlich schön singt, obwohl ihm die Regie ein inquisitorisch-hämisches Dauergrinsen gegenüber seinen Opfern aufzwingt. Als Höhepunkt einer romantischen Oper kann Wagners „Lohengrin“ die verblühende Schönheit träumerischer Utopie entfalten. Wie alle Utopie ist das aber in der dramaturgischen Dialektik von intimem Drama und staatstragendem Majestätsrahmen auch zwiespältig. In Mannheim scheint man sehr von der Zwiespältigkeit überzeugt.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 „Demokratie ist eine Lebensform“ – Daniela Danz über den Wettbewerb Demokratisch Handeln 6:25
6:25  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked6:25
Liked6:25
Leiterin Daniela Danz sagt im Gespräch mit SWR Kultur, Demokratie sei „nicht irgendwas, was Menschen da oben tun“, sondern etwas, das im Alltag gelebt werde. Ziel des Wettbewerbs sei es, dass junge Menschen erfahren, „ich bin Teil der Demokratie“. Gerade in Zeiten von Desinformation und politischen Spannungen sei das Bewusstsein für Mitgestaltung „heute genauso aktuell wie früher“. Noch bis Dezember 2026 können sich Schulen und Jugendgruppen mit Projekten bewerben – und zeigen, wie vielfältig demokratisches Handeln aussehen kann.…
S
SWR2 Kultur Aktuell
1 Wütend, aber wiederholend: Tara-Louise Wittwers „Nemesis’ Töchter" bleibt an der Oberfläche 4:09
4:09  Afspil senere
Afspil senere  Afspil senere
Afspil senere  Lister
Lister  Like
Like  Liked4:09
Liked4:09
„Was Tara sagt“ – 700.000 Follower auf Instagram Tara-Louise Wittwer erklärt und bespricht feministische Perspektiven auf ihrem Instagram-Account „Was Tara sagt“, sie kontert auf TikTok sexistischen Männern, die Dating-Tipps geben und postet humorvolle Clips, in denen sie einen Arzt spielt, der nicht weiß, was Endometriose bedeutet. Sie versteht ihre Inhalte als Einstieg in das Thema Feminismus und will andere Frauen darin bestärken, strukturelle Ungleichheiten zu erkennen. Tara-Louise Wittwer beschreibt in ihrem Buch „Nemesis‘ Töchter“ nun auch ihren eigenen Weg, der sie von einer einverstandenen Mitläuferin des Patriarchats zu einer, wie sie sagt, wachen und wütenden Frau gemacht habe. Deshalb der Titel Nemesis – die ursprünglich antike Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit wurde im Laufe der Zeit zu einer Rachegöttin umgedeutet und damit zum abschreckenden Frauenbeispiel. Nemesis ist das passiert, was vielen Frauen früher oder später im Leben passiert: Ihr Handeln wurde fehlinterpretiert, sie wurde missverstanden, Opfer falscher Narrative, die sich verselbstständigt haben. Und so wurde aus ihr, deren Name wortwörtlich eigentlich "Zuteilung des Gebührenden" bedeutet, eine rachsüchtige und unkontrollierbare Göttin, die alles niedermäht, was ihr in den Weg kommt. Dieses Narrativ ist so faul, wie es alt ist. Es geht schneller, es ist eine Abkürzung, um vor allem weibliche Wut in irgendeiner Weise abzustrafen Quelle: Tara-Louise Wittwer – Nemesis' Töchter. 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt Eine weibliche Wut, die tief sitzt Nun soll die Wut aber wiederkehren und damit auch Gerechtigkeit für die Frauen – Gründe dafür gibt es genug und Wittwer zählt sie auf: Opfer von Gewalt zu sein, belächelt zu werden, den Mental Load als Ehefrau und Mutter zu tragen, Körper- und Schönheitsidealen unterworfen zu sein, doppelt so viel leisten zu müssen, um Karriere zu machen wie ein Mann – die Liste ist endlos: Das alles ist female rage, das alles führt zu female rage. Zu einer Wut, die so tief in uns sitzt, dass sie seit Generationen vergraben ist. Es ist ein grundlegendes Gefühl von Einsamkeit, von sich-missverstanden-fühlen, von "Ich weiß eh, es wird wieder so sein." Quelle: Tara-Louise Wittwer – Nemesis' Töchter. 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt Insta-Wutmonolog in Buchform Mit allem, was Tara-Louise Wittwer in diesem zweihundert Seiten langen Insta-Wutmonolog in Buchform aufführt, hat sie vollkommen Recht. Nur leider bleibt der Eindruck von Erkenntnislosigkeit. Denn Frauen wissen, dass sie nachts alleine nicht durch den Park gehen können – Mütter wissen, dass sie überlastet sind – und wir wissen, dass Hexenverfolgungen im Mittelalter Massenmorde an Frauen waren. Die vielen Aufzählungen, die oft wie eine Sammlung ihrer bisherigen Instagram-Beiträge anmuten, und die den frauenfeindlichen Phänomenen nur oberflächlich auf den Grund gehen, nehmen großen Raum ein. Da bleibt wenig Reflexion über Wege aus der vorhandenen Ungerechtigkeit. Hier kommt die Autorin über ein allgemeines Gefühl von Schwesterlichkeit und gegenseitiger weiblicher Unterstützung nicht hinaus. Solidarität allein reicht nicht Solidarität unter Frauen und Schwesterlichkeit ist kein Konsens, sondern ein Kompass, nach dem ich leben will. Frauen, die sich nicht gegenseitig unterstützen, werden geschwächt - nicht unbedingt als Individuum, aber strukturell, gesellschaftlich und politisch. Sobald ich auf der Straße unterwegs bin und eine Frau sehe, lächele ich sie an. Weil ich weiß, sie wurde auch schon belogen oder betrogen. Quelle: Tara-Louise Wittwer – Nemesis' Töchter. 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt Deshalb bleibt am Ende die Frage offen, wie Female Rage genutzt werden kann, um Veränderungen herbeizuführen – Frauen, die sich auf der Straße zulächeln, werden die Gewalt des Patriarchats jedenfalls nicht stoppen können.…
Velkommen til Player FM!
Player FM is scanning the web for high-quality podcasts for you to enjoy right now. It's the best podcast app and works on Android, iPhone, and the web. Signup to sync subscriptions across devices.